|
Bogenhausen:
Priel

|
|
Lage
Der
wenig bekannte Ortsteil Priel in Bogenhausen liegt oberhalb des
Herzogparks auf dem Isarhochufer. Das Gebiet ist
mit einer Villenkolonie ("Am
Priel-Hof")
und mit Einfamilienhäusern
(Gartenstadt
Bogenhausen-Priel)
bebaut. Am Ostrand des Priels befindet sich
die Kleingartenanlage um den "Schlösselgarten".
Zu den modernen Bebauungen des Priels zählt das Klinikum
Bogenhausen
und das Hügelhaus
in der Titurelstraße.
Das Altenheim an der
Effnerstraße
wurde 2007 abgerissen und soll durch einen Neubau ersetzt
werden.
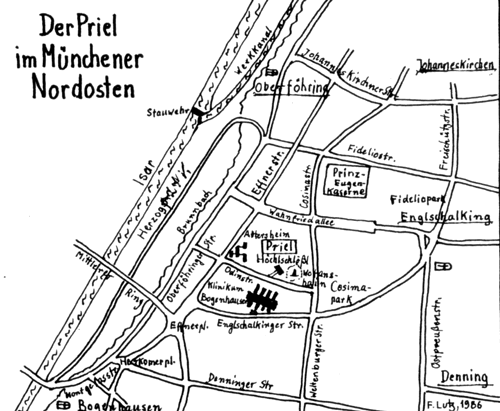
handschriftliche
Lageskizze des Ortsteil "Priel" im Jahr 1986 von Heimatforscher Fritz Lutz
Name
Der
Name "Priel" kommt vom althochdeutschen "bruil",
was
soviel heißt wie "mit Buschwerk bewachsene Wiese, auch
Tiergarten oder Wildgehege".
Er weist
aber auch auf einen alten Königshof hin, in diesem Fall auf den
Hof von Föhring. In der Nähe anderer Königspfalzen erhielten
sich ebenfalls Ortsbezeichnungen, die auf einen vermutlich
abgesonderten Wald für Edelwild hinweisen.
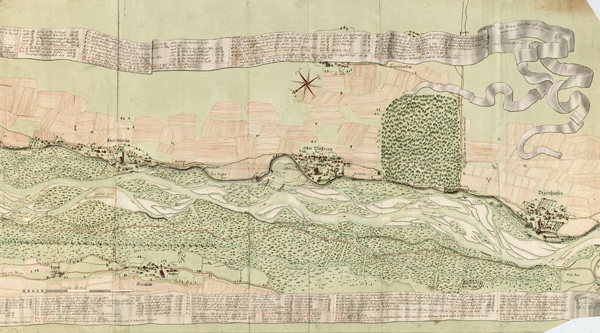
der
Prielwald im Jahr 1716 zwischen den Dörfern Oberföhring
(links) und
Bogenhausen (rechts)
Zum
Vergrößern bitte anklicken!
Historie
Im
Jahre 903 bekam Bischof Waldo von Freising von König Ludwig dem
Kind das Gut "Küntal" geschenkt, das etwa auf
dem Gebiet des heutigen St.
Emmeram
in Oberföhring stand. Zu diesem Hof gehörte auch der nahe
Prielwald, ein
ehemals locker bestandener Eichenmischwald, der sicherlich zu einem
Waldgürtel gehörte, der sich von der Lehmzunge bei Föhring
weiter nach Osten hin erstreckte. Als letzte
Reste
dieser Bewaldung kann heute der sogenannte Odins-
oder Wotanshain
angesehen werden. Jahrhundertelang
markierte der Priel die Südgrenze des Hochstifts
Freising
und trennte die Machtbereiche der Kurfürsten von Bayern und der
Freisinger Bischöfe. Mehrmals
versuchten die bayerischen Herzöge den Priel einzutauschen,
aber er blieb freisingisch - was Jäger aus München aber nicht
abhielt, in dem Grenzwäldchen unerlaubt zu jagen. Grund für
jahrhundertelange Auseinandersetzungen. Urkundlich zum
ersten Mal genannt wird der "Prül" im
Jahr 1305. Zwei
Höfe mit dem Namen Prielhöfe ("Prvelhoef") sind
schon 1288/1304 belegt.

1715/16
bestand der Weiler Priel nur aus einer Ziegelei, der ersten des
Münchner Nordostens. Sie gehörte zum Besitzstand des
Kurfürsten Max Emanuel und lieferte - über
einen "Canal auf die Ziegelhütten" - die
Ziegelsteine zum Bau der Schleißheimer und Nymphenburger
Schlossanlagen.
Der Kanal begann etwa dort, wo heute der Brunnbach fließt.
Nördlich von Freimann und südlich von Garching ist der
Wasserweg heute noch zu sehen.
Eine
Votivtafel
in der Englschalkinger Kirche St. Nikolaus zeigt ein
französisches Reiterheer, wie es aus dem "Pruelwald"
auf das Dorf zusprengt. Im Juni 1800/1801 hatten die Franzosen
unter Führung Napoleons Bayern besetzt und die Höfe der Bauern
gebrandschatzt, Frauen und Mädchen sowie die jungen Burschen
und das Vieh versteckte man im Moos aus Angst vor
Vergewaltigung, Zwangsrekrutierungen und Diebstahl.

Im
Zuge der Säkularisation wurde das Hochstift Freising 1803
verweltlicht und seine Besitztümer veräußert. Auch der 250
Tagwerk große Prielwald wurde versteigert und innerhalb weniger Jahre
abgeholzt. Ab
1810 begann hier
in
diesem Gebiet
der
Lehmabbau
im größerem Umfang.
Mehrere Ziegeleien mit Trockenstädeln und Öfen entstanden,
aber auch Wohnhäuser. Der Weiler Priel, mit vormals drei
Häusern, wuchs bis 1860 auf eine Ortschaft mit zwölf
Hausnummern an - davon fünf Ziegeleien.
Eine
davon gehörte dem Münchner
Architekturmaler Anton
Höchl,
der das vom Vater geerbte Wohnanwesen zu einer Künstlervilla
ausbaute. Höchl bewirtete Künstler und Gäste aus dem
gehobenen Bürgertum Münchens. Auch sein Nachbar, Herzog
Max in Bayern,
der sein Anwesen im angrenzenden Herzogpark
hatte, zählte zu seinen Gästen. Heute
ist die Stadt München Eigentümer und auf dem ehemaligen Höchlanwesen
steht seit 1982 das Krankenhaus Bogenhausen - aber auch die
beliebte Gaststätte "Schlösselgarten".
Von ihrem Biergarten aus sieht man noch heute die als "Höchl-Schlössl"
bekannte Villa.
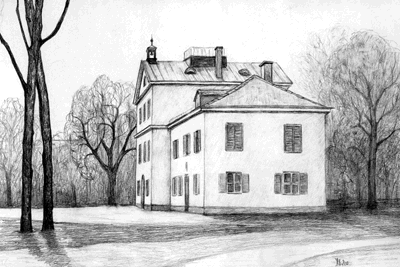
Höchl-Schlössl
Nach
Erschöpfung der Lehmvorräte im Gebiet des Priel wurden die
Ziegeleien weiter nach Norden verlegt und hinterließen eine
verwüstete Landschaft. Die Straßenbezeichnung "Am
Priel" wurde 1955 umgeändert in "Oberföhringer
Straße" und damit die letzte Erinnerung an die alte
Flurbezeichnung getilgt, bis 1987 wenigstens zwei Ortsschilder
mit der Aufschrift "Priel" beim Herkomerplatz und beim
ehemaligen Zollhäusl in Höhe der Wahnfriedallee
wieder aufgestellt wurden. Vom Lehmabbau zeugen heute noch die
tiefgelegenen Gärten an der Oberföhringer Straße.

Zollhaus
zwischen Oberföhring und Priel
An
der Stelle der mittelalterlich-bäuerlichen Prielhöfe entstand
in den 1930er Jahren die Villenkolonie "Am Priel-Hof"
sowie das heute nicht mehr existierende Gasthaus
"Priel-Hof" (heutige Oberföhringer Straße 42).
Abbildungen:
Der
Wald im Odinshain und das Wotansdenkmal
von
Heinrich Natter,
hpt
©
Verein
für Stadtteilkultur im Münchner Nordosten e.V.
Lageskizze
Priel, Fritz Lutz (1986)
Stimmungsvoller
abendlicher Prielwald,
hpt
©
Verein
für Stadtteilkultur im Münchner Nordosten e.V.
Ausschnitt
aus einer Karte von Johann Jakob Löw, 1716, Hauptstaatsarchiv Plansammlung Nr.
668/V. Oberhalb
des Priel-Waldes ist das Dorf Englschalking zu erkennen, unten
fließt die mäandernde Isar. Die Grenze zwischen dem Hochstift
Freising und dem Herzogtum Bayern verlief entlang des rechten
Waldrandes.
Zeichnung
Höchl-Schlössl © Karin Bernst, "Spaziergang
durch den Münchner Nordosten",
Kalender 2001.
ehemaliges
Zollhaus, Oberföhringer Straße 57,
links davon ist das Ortsschild "Priel" angebracht ©
dietlind pedarnig, 2008
|