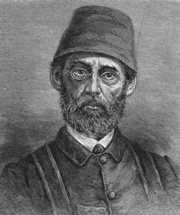Auch „Kolonialsiedlung“, ursprünglich „Erwerbslosensiedlung Zamdorf“ genannt. Die Siedlung liegt um den Emin-Pascha-Platz, die Wißmann-, Dominik-, Gröben-, Leutwein-, Ida-Pfeiffer- und Lüderitzstraße in Zamdorf. Erbaut ab 1934, erhielt die Siedlung ihren volkstümlichen Namen 1935 nach für die damalige Zeit verdienstvollen Kolonialpionieren.
So erhielt zum Beispiel die Rohlfsstraße ihren Namen nach dem Afrikaforscher Gerhard Rohlfs (1839–1896), der erstmals die Sahara in Nord-Süd-Richtung durchquerte. Andere Benennungen gelten heute als umstritten. So gilt Major Hans Dominik inzwischen als nicht mehr würdig für eine Straßennennung. Der Major „befriedete“ Kamerun, man spricht auch von Kameruns Schreckensherrscher. Als die Straße 1932 seinen Namen erhielt (Dominikstraße), sah man das noch anders und erkannte seine „Verdienste um die Erforschung und Befriedung der einstigen deutschen Kolonie Kamerun“ an.
Der Münchner Stadtrat bemüht sich um Entkolonisierung von Straßennamen. So wurde auf Antrag des Bogenhausener Bezirksausschuss im Juni 2000 beschlossen, die frühere Karl-Peters-Straße (benannt 1932 nach dem Afrikaforscher Carl Peters (1856–1918), der für das Deutsche Reich die Kolonie Deutsch-Ostafrika erwarb), in Ida-Pfeiffer-Straße umzubenennen. Patin dafür stand die Reiseschriftstellerin Ida Pfeiffer (1797–1858). Bis heute finden aber immer wieder Diskussionen über die Straßennamen in den „Kolonialvierteln“ statt. Die einfachste Lösung fand man zunächst bei der Von-Trotha-Straße (in Waldtrudering), indem man einfach die Interpretation änderte. So erinnerte die Straße nicht mehr an den Völkermörder Generalleutnant Lothar von Trotha (1845–1920), der bei der Niederschlagung des Herero-Aufstandes im Jahr 1904 im damaligen Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) als Hauptverantwortlicher eine grausame Rolle spielte, sondern an die Adelsfamilie von Trotha. Im Juli 2006 hat der Kommunalausschuss des Münchner Stadtrats mit den Stimmen von Grünen und SPD und gegen den Willen nahezu aller Anwohner die Straßenneubenennung der Von-Trotha-Straße in Hererostraße beschlossen.
Von weiteren Umbenennungen wurde bewusst abgesehen, obwohl namentlich die Rohlfs-, Wißmann- und Dominik-Straße problematisch sind. Im Bemühen um Entkolonialisierung von Straßennamen stimmte der Münchner Stadtrat im Februar 2009 für die Anbringung erklärender Zusatzschilder („Kolonialgeschichte offenlegen“). Auf diese Weise soll an die kaum bekannte und oft verharmloste Epoche der deutschen Kolonialzeit mahnend erinnert werden.