In Steinhausen wurde zur Gasversorgung der königlichen Haupt- und Residenzstadt ab 1881 nach Plänen von Nikolaus Heinrich Schilling (1826–1894; Gasdirektor) ein zweites Gaswerk für München gebaut, denn die Kapazitäten der bisherigen Gasanstalt in der Thalkirchner Straße 34 reichten für die Herstellung von Leuchtgas nicht mehr aus. 1883 war das Gaswerk am Kirchstein fertiggestellt und es konnte mit der Produktion begonnen werden.
- Start
- Architektur
- Gaswerk am Kirchstein
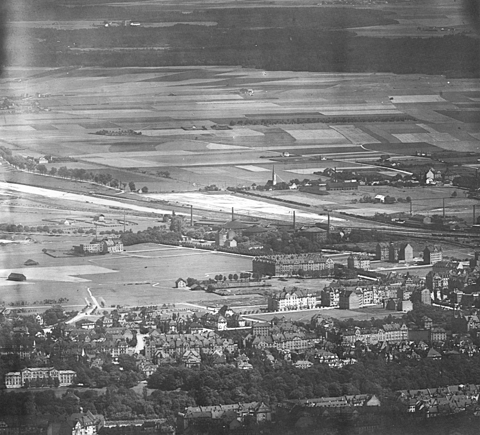
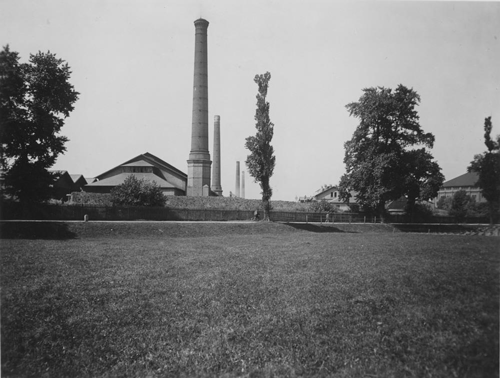
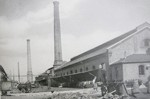
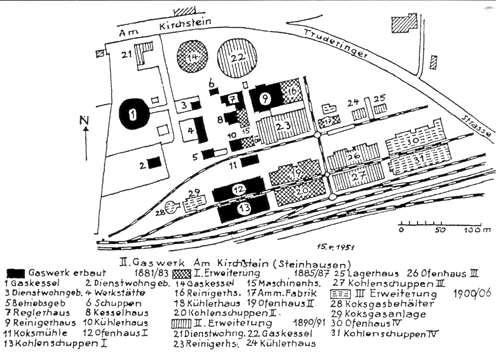


Gaswerk am Kirchstein
Steinhausen
Weiterführende Informationen
Das Gaswerk lag südlich des heutigen Vogelweideplatzes und erstreckte sich im Süden bis zum Bahngelände. Im Osten schloss es mit der Truderinger Straße ab. Das Straßenstück der heutigen Einsteinstraße, unmittelbar vor dem Werksgelände, trug den Namen „Am Kirchstein“. Das Gaswerk hatte seinen Namen von einer Ziegelei. „Zwei östlich von Haidhausen liegende Ziegeleien (Bereich Leuchtenbergring) tragen seit ca.1820 den Namen „Neustein“. Der Kirchenbauausschuss für St. Johannes gab dem Ziegelstadel nebst Lehmgrund, welchen er 1855 käuflich erwarb, die Bezeichnung „Kirchstein“, weil dort die Steine der neuen Pfarrkirche erzeugt wurden.“ (Karl Graf von Rambaldi“:“ Münchner Straßennamen und ihre Erklärung“, 1894)
Bereits in den Jahren 1885 bis 1887 erfolgte die erste Erweiterung – ein zweiter Gasbehälter war notwendig geworden – dem 1891 der größte, östliche Gaskessel folgte. Am 19. September 1894, nach einem Machtspruch des Ministerium des Innern, wurden aus dem Gemeindegebiet von Berg am Laim (Ortsteil Zamdorf) 9,3 Hektar nach München eingemeindet. Im Jahre 1899 übernahm dann die Stadtgemeinde München das Gaswerk. Nachdem elektrische Energie das Gas immer mehr verdrängte, wurde 1927 die Erzeugung von Leuchtgas am Kirchstein eingestellt, die Behälter blieben als Lagerräume bis zur Kriegszerstörung erhalten. Anfang der 1930iger Jahre begann der Abbruch der veralteten Nebengebäude.
Die Gasbehälter wurden 1943 abgebaut, nachdem sie infolge des Fliegerangriffs am 20. September 1942 ausbrannten. Das Foto zeigt einen Gaskessel nach der Zerstörung durch die eingesetzten Minenbomben 1942.
Auf dem ehemaligen Werksgelände an der Einsteinstraße 130 errichteten die Stadtwerke 1953 bis 1954 den Omnibus-Betriebshof Ost.
Textquelle: „Dörfer auf dem Ziegelland“, hrsg. von Willibald Karl, 2002
